Ausgangsposition
Ich hatte das Haus meiner Eltern in Bürs (Vorarlberg) zu renovieren. Meine Eltern hatten das Haus 1974 errichtet; das war kurz nach der Ölpreiskrise im Herbst 1973, die zu einem „Ölschock“ geführt hatte. Meine Eltern verzichteten deshalb auf eine Ölheizung und bauten – Strom war relativ „billig“ – eine Elektrospeicherheizung ein.
(Der sog. „Ölschock“ bestand in einer Verknappung von Erdöl und einem daraus folgenden empfindlichen Preisanstieg für Benzin, Diesel etc. von ca. 70%. 1973 – ich kann mich noch gut erinnern – lernte der globale Norden das erste Mal die Notwendigkeit des „Sparens von Energie“ kennen. In Österreich führte das z.B. zur Einführung „autofreier Tage“: man musste per Pickerl deklarieren, an welchem Wochentag man das eigene Auto nicht in Betrieb (!!!) nahm. Außerdem gab es Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Ja, 1973/74 war der „Schock“ so groß, dass Maßnahmen möglich waren, die man auch heute bräuchte; dringend. Aber damals ging es ums Geld, heute geht es bloß „um die Zukunft“.)
Einige Jahre später wurde Strom wieder teurer; Gas war dem gegenüber relativ billig. Meine Eltern reagierten, indem sie das Haus von einer Elektroheizung auf eine Gasheizung umrüsteten. Es wurden nachträgliche Heizungsleitungen durch das ganze Haus gezogen und neue Heizkörper installiert – ein durchaus aufwändiger Schritt.
Ich fand nach dem Tod meiner Eltern ein Haus vor mit einer mittlerweile sehr alten und störungsanfälligen Gasheizung. Prinzipiell ist der Schritt „raus aus dem Gas“ aus Klimaschutzgründen heute sowieso dringend nötig; bei „meinem“ Haus war er darüber hinaus technisch überfällig.
Sanierung
Ich konsultierte (schon im Jahr 2022) Bauplaner, Heizungsexperten, Umweltexperten und entschied mich für eine Heizung auf Basis einer Wärmepumpe, unterstützt durch eine eigene Stromversorgung per Photovoltaik auf dem Dach. Allerdings musste ich im Mai 2022 kurz nach meinem Pensionsantritt feststellen: ich war für eine Realisierung im Jahr 2022 hoffnungslos verspätet. Es wurde 2023; ab 3.4. erfolgte die Durchführung des Verfahrens. Die Bauzeit war bis 17.5. geplant; es wurde ein bisschen länger, weil das Wetter nicht immer mitspielte. Letztlich waren die wesentlichen Arbeiten am 7.6. erledigt; es entspann sich aber noch eine Zielgerade vieler kleiner Schritte, von denen der allerletzte auch heute noch nicht getan ist.
Die Sanierung umfasste allerdings deutlich mehr als bloß die Installation der Wärmepumpe. Aus der Devise „raus aus dem Gas“ entstanden … die zusätzliche Dämmung des gesamten Gemäuers, die Dämmung des Dachs mit neuer Deckung, neue, der neuen Dämmung entsprechende Fenster, neue elektrische Schaltungen usw. usf. Die Photovoltaik-Anlage wäre dazu noch nicht nötig gewesen, ergänzte das Sanierungskonzept aber sinnvoll. (Wärmepumpen brauchen – relativ wenig – Strom; dieser Strom muss sichergestellt sein.)
Am 30.6. wurde die Photovoltaik-Anlage eingeschaltet. Seither „produziere ich“ Strom.
Sanierungsparameter
Die Sanierung verbesserte das Haus in zählbaren Parametern. Beim Heizwärmebedarf (HWB) weist der Energieausweis nun einen Wert von 61 aus: wir sind da bloß in Klasse C. (Hier rächt sich, dass meine Eltern 1974 nicht mehr an eine Unterkellerung des Hauses gedacht hatten.) Beim Primärenergiebedarf landet das Haus nun bei 47 oder Klasse A++, bei den „äquivalenten CO2-Emissionen“ weist der Energieausweis einen Wert von 6 aus, also auch A++, beim Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE landen wir bei 0,67 oder Klasse A+.
Wir sind auf dem Weg zum „Niedrigenergiehaus“.
Die PV-Anlage
Die PV-Anlage besteht aus 24 monokristallinen Solarpaneelen, die jeweils knapp 2 qm groß sind. Sie bedecken die Süd-Ost-ausgerichtete Hälfte des Dachs praktisch zur Gänze und liefern eine Leistung von knapp 10 kWp („kiloWatt peak“), könnten also im Idealfall etwa 10 kW liefern. (Wenn sie das eine Stunde lang täten, wären das 10 kWh. Das ist die Maßeinheit, in der Strom verrechnet wird.)
Diese Solarpaneele liefern über ein Leitungssystem solaren Gleichstrom an ein Zentralgerät, den sog. „Wechselrichter“. Der macht aus dem solaren Gleichstrom Wechselstrom, den man im Haushalt verwenden oder ins elektrische Netz einspeichern kann. „Mein“ Wechselrichter kam mit einer Software, die mir die Beobachtung der Wirkung der Anlage ermöglicht. Ich kann jederzeit sehen, wie viel Strom meine PV-Anlage aus Sonnenlicht erzeugt, wie viel davon im Haushalt verwendet wird und wie viel ins Netz eingespeichert wird.
Kosten?
Die Kosten? Die Paneele kosteten netto ca. 5.500 €, die Unterkonstruktion für die Paneele auf dem Dach ca. 3.000 €, die Montagearbeiten ca. 2.000 €, etwas mehr noch der Wechselrichter usw. usf. Insgesamt komme ich auf Kosten für die PV-Anlage von ca. 19.300 € (incl. MWSt. und Skonti). Laut Marktbeobachtung komme ich da relativ „günstig“ davon, obwohl ich z.B. hochwertige Paneele verwenden ließ.
Förderungen?
Es gibt vom Land Vorarlberg derzeit keine eigene Förderung für Solaranlagen. Es gibt aber eine Bundesförderung: deren Beantragung hat offenbar die Errichterfirma übernommen. Im Land Vorarlberg gibt es allerdings noch einen „Sonderbonus“ von 0,15 € pro ins Stromnetz eingespeister kWh, und zwar bis 31.12.2023.
Der erste Monat: Juli 2023
Der Juli 2023 geht vermutlich als der heißeste Monat aller Zeiten in die Klimabeobachtung ein. Für meinen Heimatort Bürs stimmt das nur bedingt: praktisch alle Tage waren „bewölkt“ oder „stark bewölkt“, auch „mit Regen“; ein einziges Mal war es „wolkenlos“. Also für einen solaren Jungunternehmer wie mich kein „ideales“ Wetter. Ein einziges Mal sah ich für meine Anlage eine Auslastung von 98% – so hoch war es fast nie; oft musste ich mit 60%, 50% zufrieden sein. Das zeigt sich in der Gesamtübersicht für den produzierten Strom pro Tag:
Man sieht: der Produktionszweig, in den ich eingestiegen bin, ist sehr wetterabhängig. Meine PV-Anlage schaffte es gerade an 3 Tagen (am 7.7., am 9.7. und am 15.7.) mehr als 60 kWh zu produzieren. Am „schlechtesten“ Tag (dem 21.7.) kamen wir nur (!) auf 17,55 kWh – das ist aber für meinen Haushalt immer noch etwa das Dreifache eines durchschnittlichen Tagesverbrauchs.
In Summe macht das für den Juli eine Gesamtproduktion an solarem Gleichstrom von ca. 1.272 kWh aus, also 1,272 MWh. Davon ging der Großteil ins Netz: ich habe in den österreichischen Strommarkt ca. 1,2 MWh eingebracht, „eingespeist“. Für jede eingespeiste kWh bekomme ich von meinem Stromversorger 9 Cent, also etwas weniger als ich in Anbetracht der Strompreisbremse zu bezahlen haben werde. (Käme ich wegen zu hohen Stromverbrauchs nicht mehr in den Genuss der Strompreisbremse oder würde sie abgeschafft, würde mein Stromanbieter derzeit ca. 19 Cent pro kWh von mir verlangen.) Ab einer Einspeisung von insgesamt 3,501 MWh reduziert sich der Strompreis, den ich pro kWh bekomme, an sich auf nur mehr 7 Cent. Durch den „Sonderbonus“ erhöhen sich diese Preise aber bis 31.12.2023 um 15 Cent auf 24 Cent bzw. 22 Cent. Ja, das ist eine Art „Förderung“ von Solarstrom; sie ist aber, wenn man wenig Erfahrung hat, schlecht kalkulierbar.
Ich habe im Juli insgesamt etwa knappe 300 € erwirtschaftet. Leben könnte ich davon nicht, aber es ist ein Vielfaches von dem, was mich der Strom monatlich kostet.
Das ist nun das Ergebnis eines relativ stark bewölkten Julis. Wie das wird, wenn die Sonne im Herbst und im Winter nicht mehr so lange und vor allem deutlich „flacher“ scheint, wird sich zeigen. Ich hoffe, dass ich im schlechtesten Fall „pari“ aussteige.
Amortisation?
Ich rechne mit einer Amortisationszeit der PV-Anlage von ca. 9 bis 11 Jahren – das ist so auch marktüblich. In 11 Jahren bin ich 77: das kann ich evtl. noch erleben. Wenn die Strompreise steigen, verkürzt sich die Amortisationszeit.
CO2
Meine PV-Anlage sagt mir, dass ich mit ihr nun bereits über 713 kg CO2 eingespart habe, denn Strom wird ja immer noch zu gewissen Teilen mit fossilen Brennstoffen und also mit CO2-Emissionen erzeugt.Die 713 kg eingespartes CO2 entsprechen – sagt die Firma – einem durchschnittlichen Strommix, wie er am Markt üblich ist.
Meine PV-Anlage rechnet das in (derzeit) 18 Bäume um, die man pflanzen, pflegen und aufziehen müsste, um die gleiche Menge an CO2 zu speichern. (Bäume, Pflanzen überhaupt, „inhalieren“ ja CO2 und geben Sauerstoff an die Umgebung ab. Aus dem Kohlenstoff machen sie Stämme, Äste, Zweige und Blätter. Man nennt das „Photosynthese“.)
Meine PV-Anlage sagt mir auch, dass dieses eingesparte CO2 der CO2-Emission eines Verbrennerautos entspricht, das ca. 2.800 km gefahren ist. Ich finde diese Umrechnungen in „Bäume“ und „Autokilometer“ anschaulich und „charmant“; wirklich glauben tu ich sie nicht; man muss das „mit Weisheit“ lesen.
Schluss
Ich bin der Meinung, dass Hausdächer ein enormes Potenzial für unsere Wirtschaft, unseren Energiehaushalt und für eine erfolgreiche Klimapolitik bieten. Alte Häuser zu sanieren, zu renovieren: das würde unglaublich viele Arbeitsplätze schaffen: man müsste allenfalls heftig in die Fortbildung investieren. Alte Häuser sanieren erspart auch den Bau neuer Häuser. Jedes zusätzliche Haus ist zusätzliche Bodenversiegelung.
Man kann die Errichtung von Photovoltaik fördern – das geschieht in gewissem Ausmaß. Man könnte auch die Verweigerung von Photovoltaik besteuern. Man könnte nicht nur: man sollte auch.
Ausnahmsweise und ausdrücklich möchte ich auf das u.a. posting meines Freundes D.M. hinweisen, der Beispiele nennt, wie es im gemeinschaftlichen Wohnbau mit PV-Anlagen gehen kann und wo es hakt.
mb
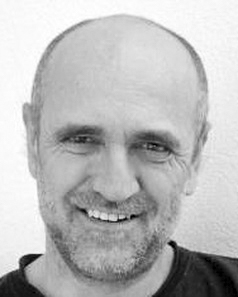

Schreibe einen Kommentar