Keine friedliche Koexistenz mehr
In den letzten Jahren hat sich der relativ angenehme Zustand der „friedlichen“ Koexistenz zwischen mir und einer Bakterienpopulation in meinem linken Schienbein, den ich als „Ich bin viele“ am 16.11.2018 beschrieben habe, leider aufgelöst. Meine gewohnten Staphylokokken („aureus“) haben sich verzogen und mein Ulcus (Geschwür) am linken Fuß ist durch wechselnde Keime immer wieder neu besiedelt worden: verschiedene Staphylokokken, verschiedene andere relativ „gängige“ Keime, manchmal waren sie gleichzeitig zu zweit oder zu dritt – und meine behandelnden Ärzt:innen haben mit Antibiotika reagiert. Seit 2014 habe ich da 11 verschiedene Präparate bzw. Wirkstoffe in abwechslungsreicher Reihenfolge kennen gelernt; ein Medikament habe ich abgelehnt, weil es für mich gefährliche Nebenwirkungen hervorrufen hätte können – da haben mir der Beipackzettel und meine Hausärztin abgeraten – und beim letzten Antibiotikum habe ich das erste Mal echte und unangenehme Nebenwirkungen verspürt und es abgesetzt. (Auch dieses wäre ziemlich teuer gewesen.) Nach 2, 3 Tagen waren die Nebenwirkungen wieder weg und ich war seit mehreren Jahren wieder einmal ohne Antibiotika, aber mit einem Keim. (Die ganze lange Liste „meiner“ Antibiose hab ich auch nur, weil meine Krankenkasse bei einem sehr teuren Medikament von der Klinik wissen wollte, was denn sonst schon so alles probiert worden sei.)
Im Moment bzw. seit einigen Wochen ist „Stenotrophomonas maltophilia“ zu Gast in meinem Ulcus und ein Hindernis für eine Heilung – und die Infektiologie in Innsbruck hat gemeint, dass der besser gehen sollte; mit dem sei nicht zu spaßen. Man solle was tun.
Neue alte Behandlungsmethoden: „Biochirurgie“, 1. Teil
Nachdem das Arsenal an Antibiotika i.W. erschöpft ist – ein Zustand, der durch die Zunahme von Resistenzen für viele Menschen immer häufiger wird, habe ich nach Alternativen gesucht. Gemeinsam mit meinen betreuenden Ärzt:innen an der Innsbrucker Klink sind wir auf die „Madentherapie“ gestoßen. Da werden im Ulcus Fliegenmaden in einem Gaze-Beutel angesetzt: die fressen Bakterien und nehmen deshalb in wenigen Tagen sehr an Größe zu. Jetzt bin ich im Krankenhaus und die Maden „arbeiten“: sie fressen.
Man findet das auch unter dem Titel „Biochirurgie“. „Chirurgie“ ist i.W. der „operierende“ Teil der Medizin; es operieren in aller Regel Ärzt:innen. In der „Biochirurgie“ lässt man andere „operieren“: die „Biologie“, z.B. Fliegenmaden.
Heute haben meine madigen Operateure angefangen und ich werde schon gefragt, ob ich was spüre: ein Krabbeln zum Beispiel. Nein, ein Krabbeln spüre ich nicht, eher ein „Ziehen“ im Ulcus, aber das habe ich auch sonst manchmal. Ich hoffe, die Maden arbeiten; sehen tu ich nix, weil sie das unter einem Verband machen: Es ist alles klinisch sauber; nichts ist ekelerregend. Es gibt aber offenbar Bakterien, die die Maden nicht mögen, sondern die den Maden schaden; die Maden sollten außerdem in der Lage sein, selbst zwischen Bakterien als Futter und (meinen) menschlichen Zellen, die nicht Futter werden sollen, zu unterscheiden.
Die Madentherapie – das wird im verlinkten Wikipedia-Artikel recht genau aufgearbeitet – hat eine lange Geschichte, die in Europa bis ins 17. Jahrhundert reicht. (Auf anderen Kontinenten geht es noch viel weiter zurück.) Mit dem Aufkommen der Antibiotika geriet sie fast in Vergessenheit; jetzt, mit immer mehr gegen Antibiotika resistenten Keimen, wird sie wieder interessant. Noch nicht sehr: an der Innsbrucker Klinik haben wir niemand gefunden, der sich damit beschäftigen wollte, aber ich habe eine Wundmanagerin und Madentherapie-Expertin in Hall gefunden. Vielen Dank! Ich hoffe, dass ich bald von Erfolgen berichten kann.
Neue alte Behandlungsmethoden: „Biochirurgie“, 2. Teil
In der Madentherapie fressen relativ große Lebewesen – Fliegenmaden – relativ kleine, nämlich die Bakterien. Es geht auch anders.
Auch unter dem Stichwort „Biochirurgie“ findet man die „Phagentherapie“. „Phagen“ steht hier kurz für Bakteriophagen; das sind Bakterien fressende Viren. Die sind deutlich kleiner als die Bakterien. Auch die Geschichte der Phagentherapie wird im entsprechenden Wikipedia-Artikel gut aufgedröselt: sie hat sich am Beginn des 20. Jahrhunderts v.a. in der ehemaligen Sowjetunion, besonders in Georgien entwickelt, aus dem gleichen Grund, der für die Madentherapie relevant war: weil es dort praktisch keine Antibiotika gab. Und sie ist ebenfalls durch das Aufkommen der Antibiotika fast in Vergessenheit geraten.
In der Phagentherapie „dressiert“ man Viren – heute auf biochemisch-molekularbiologischem Weg, dass sie Bakterien „fressen“ und hofft darauf, dass nach dem letzten gefressenen Bakterium die Viren „brav“ bleiben und auf keine „dummen Gedanken“ kommen. Im Westen – in Deutschland, Benelux und anderen Staaten – arbeitet man heute an hochspezialisierten Universitätsinstituten daran, die georgischen Erkenntnisse zu Phagen auf eine profunde schulmedizinische Basis zu stellen. Im Gegensatz zu den Maden werden die Phagen auf bestimmte Bakterien gentechnisch zugeschnitten. Ich habe da das persönliche Glück, auf recht direktem Weg Näheres erfahren zu können.
falls …
Falls „meine“ Maden versagen, wäre das eine letzte Möglichkeit. Da müsste ich aber nicht nach Hall, sondern nach Berlin oder Brüssel … Oder Amputieren. Aber ein Orthopäde an der Innsbrucker Klinik hat mir versichert, dass er dafür keinerlei Indikation erkennen könne.
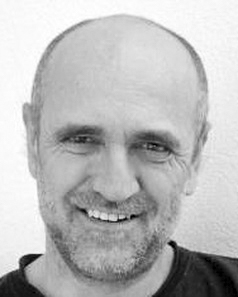
Schreibe einen Kommentar