„Soziale Medien“
Sogenannte „Soziale Medien“ sind Teile des Internets, die nicht völlig öffentlich sind. Um an ihnen voll teilzuhaben, muss man sich anmelden. Bei der Anmeldung muss oder soll man Daten von sich preisgeben: damit man von den Medien „besser“ angesprochen werden kann – heißt es. Wenn ein Medium meine Interessen kennt, kann es mich auch gezielter mit Werbung ansprechen. Von Werbung leben diese Medien; eigentlich sind sie Werbeagenturen mit angeschlossenem Diskussionsforen: das gilt für Facebook, youTube, Instagram, tikTok – alle! Das ist nicht das allgemein öffentlich zugängliche Internet.
Insofern richten sich diese Medien nur an ihre Benutzer*innen – und auch da jeweils nur an Gruppen. Insofern sind sie „sozial“: sie wenden sich an Gruppen. An Gruppen angemeldeter user; an angemeldete user mit gemeinsamen Interessen.
Kundenbindung
Es liegt im Interesse einer Firma, die von Werbung lebt, Kunden an sich zu binden: Kundenbindung ist das Um und Auf. Deswegen analysieren diese „sozialen Medien“ die Wünsche und Interessen, indem sie die Klicks der user analysieren. Wenn ich mich für Fußball interessiere, bekomme ich besonders erfolgreiche (häufig angeklickte) Fußballvideos angeboten; wenn ich mich fürs Kochen interessiere, bekomme ich (häufig angeklickte) Rezepte; wenn ich mich für Gewalt interessiere, bekomme ich (häufig angeklickte) Gewalt angeboten. Das führt zu Zuspitzung und Verstärkung. Das ist an sich als Strategie schon „populistisch“.
Das tun nicht Menschen, das tun sogenannte „Algorithmen“, also programmierte Verfahren. Der Zweck dieser Verfahren ist Kundenbindung, nicht politische Beeinflussung.
Weil das per se immer zu Verstärkung und Zuspitzung führt, sind diese Medien aus meiner Sicht eher „asozial“ als „sozial“. Die user teilen sich in „bubbles“ auf: in „Blasen“ eines gemeinsamen Interesses. „sozial sein“ heißt für mich aber: andere wahrnehmen, zuhören, verschiedene Meinungen austauschen, Diskussion und Diskurs. Die asozialen Medien verstärken aber Meinungen und Orientierungen bis zur Gewaltbereitschaft und darüber hinaus. Sie stellen sich als Quelle für die Verbreitung von Hass im Netz heraus.
[Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich asozial nicht als Eigenschaft von Menschen beschreibe – das wäre mehr oder minder Nazi-Terminologie – sondern als Eigenschaft von Software-Produkten bzw. Medien. Die sog. „neuen Medien“ sind aus meiner Sicht „Asoziale Medien“, weil sie den Menschen in seinen Interessen „zuspitzen“ und vereinsamen.]
Asoziale Medien und Politik
Man kann mit asozialen Medien Politik betreiben. Besonders die rechtspopulistischen Parteien sind da relativ erfolgreich. Klar: die asozialen Medien sind ja an sich populistisch. Man kann durch entsprechende Bilder und Videos Meinungen verstärken und zuspitzen. Wir bekommen dann große „Blasen“ von Menschen, die sich informiert und in ihrer Informiertheit verstärkt fühlen und gar nicht mehr merken, dass die Informationen, die sie bekommen, unter Umständen höchst verdreht, verkürzt und verfälscht sind. Man kann Menschen damit bis zur Gewalttätigkeit treiben. Viele Menschen „informieren“ sich fast nur noch durch ihre Blasen; traditionelle Medien – seriöse Zeitungen und Zeitschriften, seriöse Radio- und Fernsehsender – verlieren an Bedeutung.
Wie funktioniert das? Durch einprägsame Bilder und kurze Videos und kurze Texte; längere Argumentationen sind damit nicht möglich. Es geht darum, „Informationen“ – die oft nur Meinungen sind – auf einen Punkt zu bringen. Das muss leicht merkbar sein: im gelungenen Fall handelt sich um sog. „memes“.
Lernen und Verbessern
Davon kann man lernen; man muss allerdings auch die Grenzen sehen und überwinden. Es ist heute nötig, Inhalte auf eine kurze, leicht merkbare, einprägsame Form zu bringen – in der Zeit von smartphones ist es das, was ich „tiktok-Format“ nennen würde: kurz (maximal 20 Sekunden), lustig / satirisch / witzig, aufrechtes Bildformat (fürs Handy geeignet), untertitelt (damit man es auch ohne Kopfhörer überall abspielen kann).
Was damit nicht geht: ausführliche, komplexe Argumentationen herzustellen, umfassende, nachvollziehbare Information zu geben. Die Konstruktion der asozialen Medien ist – wie gesagt – an sich schon populistisch. Wenn man vernünftige Debatten will, braucht es dazu web sites, die nicht „social media“ sind. Wir brauchen einerseits die memes als Merkinhalte und Wegweiser, und andrerseits dazu Seiten, die vollständige, nachvollziehbare Argumentationen liefern. Das ist eine wichtige zweite Ebene, die die Vorteile asozialer Medien nutzt und die Nachteile abfedert. Und wir brauchen stabile Verbindungen zwischen diesen Ebenen.
*
Ich vermute, dass der große Erfolg, den Heidi Reichinnek, eine Abgeordnete der Linken in Deutschland, mit sog. „social media“ hatte und hat, in einer guten Vernetzung zwischen ihren social-media-accounts und klassischen web sites begründet ist.
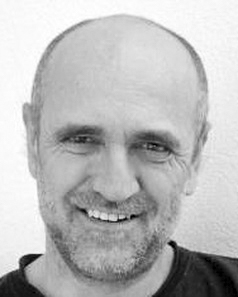
Schreibe einen Kommentar