Richtiges Ziel!
Die Europäische Union will den sexuellen Missbrauch von Kindern im Netz effektiver bekämpfen. Ja, das ist ein vernüntiges und dringend notwendiges Ziel. (Ich würde aber auch den sexuellen Missbrauch von Kindern außerhalb des Netzes bekämpfen wollen. Jeden sexuellen Missbrauch.)
Geeignete Mittel?
Um das Ziel zu erreichen, arbeitet die EU seit 2022 an der sog. CSAD-Verordnung. „CSAD“ steht für „Child Sexual Abuse Regulation“. CSAD „verpflichtet Anbieter von Messengern, E-Mail-Diensten und Cloud-Speichern, sämtliche Inhalte vor der Verschlüsselung automatisiert auf Missbrauchsmaterial zu prüfen“.
Was bedeutet das? Wenn Daten verschlüsselt über Mail, Messenger oder in Cloud-Dienste übermittelt werden, müssen sie vor der Verschlüsselung auf Missbrauchsmaterial geprüft werden. Das muss auf den Geräten der Nutzer:innen stattfinden, entweder über die Übermittlungssoftware oder direkt über das Betriebssystem. Ein Mail-Programm müsste also bei jeder Übermittlung die Mail und die Attachments auf Kindesmissbrauchsdarstellungen überprüfen.
Der Haken dabei: ob ein Material auf sexuellen Kindesmissbrauch geprüft wird oder auf andere Inhalte, ist nur mehr ein minimaler Unterschied. Man öffnet damit allgemeiner Überwachung technisch Tür und Tor.
Die EU will da auf eine Mischung aus Abgleich über Datenbanken mit bekannten Missbrauchsdarstellungen und auf KI zur Erkennung neuen Materials setzen. Man weiß aber aus Untersuchungen, dass KI da sehr fehleranfällig ist. „Im September haben über 500 Kryptografie- und IT-Sicherheitsforschende in einem offenen Brief vor dieser Technik gewarnt. Die Systeme seien fehleranfällig und würden zwangsläufig Millionen falscher Verdachtsmeldungen erzeugen“, heißt es im zitierten ORF-Artikel. „Millionen falscher Verdachtsmeldungen“: das wäre nicht mehr administrierbar.
Der Datenschützer Thomas Lohninger vom österreichischen Datenschutzverein epicenter.works hält „das gewählte Mittel [für] unverhältnismäßig und technisch ungeeignet“; er befürchtet, „dass Europa mit der Chatkontrolle ein Werkzeug schafft, das autoritäre Staaten längst nutzen – und das in falschen Händen zum Albtraum wird.“
Die österreichische Lösung
Im Gegensatz zu einer allgemeinen Überwachung arbeitet Österreich derzeit „an einer gezielten Messenger-Überwachung mittels Staatstrojaner. Dabei wird in Geräte einzelner Verdächtiger eingebrochen, um verschlüsselte Chats mitzulesen – eine Maßnahme, die richterlich genehmigt werden muss.“ Das ist für Lohninger „zwar ein schwerer Eingriff, aber kein anlassloser Massen-Scan wie auf EU-Ebene“.
Ich denke, darauf könnte man sich verständigen: Der Staat wird auf Richterbeschluss aktiv, wenn ein konkreter Verdacht besteht. Man überwacht nicht permanent alle Bürger:innen auf alle möglichen Inhalte.
EU gespalten
In der EU zählen anscheinend „Frankreich, Spanien, Italien und Irland“ zu den Befürwortern, während „die Niederlande, Belgien, Polen, Tschechien und Österreich den Vorschlag ablehnen“. Deutschland steht offenbar mitten drin, aber für die Justizministerin Hubig (SPD) ist „eine anlasslose Chatkontrolle in einem Rechtsstaat tabu“.
Meine Position
Ich würde mir sowieso nicht nur eine „Child Sexual Abuse Regulation“, also ein „Regelwerk“ oder eine „Verordnung“ für sexuellen Kindesmissbrauch wünschen, sondern ein strenges Verbot („prohibition“ statt „regulation“) mit hohen Strafen für alle Täter und alle Produzent:innen von Foto- und Filmmaterial über Kindesmissbrauch. Und man muss auch den Markt trocken legen, also auch die Nachfrage unter empfindliche Strafe stellen. Die anlasslose Überwachung ganzer Bevölkerungen ist aber sinnlos und führt auf schnellem Weg zu einer Umgehungskriminalität. Mit ein bisschen Informatik-Wissen kann man sich da leicht Um- und Schleichwege vorstellen. Die Regierungen würden eine Sicherheit vorgaukeln, die nicht wirklich besteht.
Wenn man – die österreichische Lösung – auf konkreten Verdacht und richterlichen Beschluss tätig wird, ist das sehr viel sinnvoller und vor allem machbar.
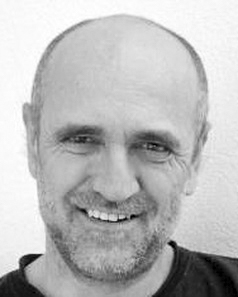
Schreibe einen Kommentar