Strom im Wandel
Die Stromerzeugung hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Zu einigen wenigen riesigen Stromkonzernen sind Tausende „Kleinkraftwerke“ dazu gekommen. Das hat z.B. zum Ergebnis geführt, dass Österreich wieder Stromexporteur geworden ist.
Das löst natürlich noch nicht alle Probleme der Zukunft. Wir produzieren zwar schon mehr Strom (als wir derzeit verbrauchen); aber der Verbrauch wird noch massiv steigen. Wenn der Verkehr – was mittlerweile absehbar ist – auf Elektromobilität umgestellt ist, wenn auch die Industrie mit grünem Strom arbeitet und wenn – last not least – auch die „Künstliche Intelligenz“, die viel Strom frisst, sich immer stärker durchsetzt, werden wir noch viel mehr Strom brauchen.
Aber die „vielen kleinen“ machen für die „wenigen Riesen“ das Stromgeschäft weniger planbar. Deshalb hört man oft die Klage der Konzerne über die „Netzinstabilität“. Tatsächlich sind 1000e Stromerzeuger weniger leicht zu administrieren als ein paar große. Und tatsäschlich ist es mit der Erzeugung von Strom noch nicht getan: er muss gespeichert und „transportiert“ werden. Es braucht also große Speicher und leistungsfähige Leitungen. Das können die „vielen kleinen“ nicht ohne Weiteres leisten.
Ein Artikel sagt das Gegenteil
In t3n.de ist am 7.9. ein Artikel von Sophia Rödiger unter dem Titel „Zu viel grüner Strom? Warum die Sorge um Netzinstabilität unbegründet ist“ erschienen. („t3n digital pioneers“ ist eine technische Fachzeitschrift mit entsprechender web site.)
Die Autorin sieht die Probleme durchaus:
In nur zwei Minuten strahlt die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Doch dieses Potenzial entfaltet sich nur, wenn wir es intelligent speichern, steuern und nutzen. […]
Dafür braucht es eine zukunftsgerichtete Politik. Stattdessen erleben wir eine Rolle rückwärts: Die Bundesregierung [Anm. mb: gemeint ist die deutsche] plant neue Gaskraftwerke mit 20 Gigawatt Leistung, finanziert von der Allgemeinheit. Die Begründung: Zu viel grüner Strom gefährde angeblich die Netzstabilität. Das ist, als würde man eine kostenlose, sprudelnde Wasserquelle entdecken – und dann aus Angst vor „zu viel sauberem Wasser“ den Hahn zudrehen.
Frau Rödiger nennt als wichtiges Faktum:
In den letzten zwei Jahren ist die Kapazität von Stromspeichern in Deutschland um 150 Prozent gestiegen.
Also die Speichermenge steigt in großen Schritten – und sie wird das weiterhin tun. An neuen Speichertechnologien wird intensiv und erfolgreich geforscht. Jetzt geht es noch um die Vernetzung dieser i.W. dezentralen Speicher.
Ein Schlüssel dafür können Smart Meter sein. Diese intelligenten Stromzähler vernetzen Solaranlagen, Speicher, Wärmepumpen, E-Autos und Haushaltsgeräte
Die andere, zusätzliche Chance sieht die Autorin in der KI:
Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist in der Lage, Wetterdaten, Verbrauch und Netzauslastung in Echtzeit zu analysieren, Prozesse automatisch zu steuern und sogar den Stromhandel zu optimieren. Auf diese Weise kann ein stabiles und flexibles Energiesystem entstehen, das Haushalte und Anlagen zu virtuellen Kraftwerken vernetzt.
Die KI und ich
Ich halte die KI, die wir heute kennen, für massiv überschätzt. Schüler:innen setzen das mittlerweile zum Schreiben von Texten für Hausaufgaben ein – und man merkt es. Es kommen Bücher auf den Markt, die „von KI geschrieben“ worden sind – und man merkt es. Manche KI-Produkte sind geradezu lächerlich. Aber das liegt daran, dass das Schreiben ordentlicher Texte nicht ohne Weiteres „künstlich“ erfolgen kann. (Manche KI-Produkte sind aber auch „erstaunlich brauchbar“.)
Was KI kann: schnell organisieren und rechnen: schneller als Menschen. Deswegen ist die Idee, die Stabilität des Stromnetzes mit KI zu erreichen, durchaus realistisch. Da geht es um eine große Menge harter Fakten, die sich laufend ändern und in eine Koordination gebracht werden müssen. Ja, ich denke, das kann KI können.
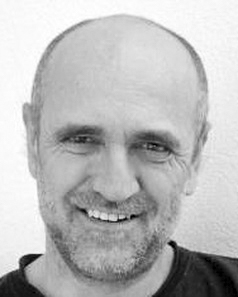
Schreibe einen Kommentar