1. Konsens und Gruppengröße
1.1. Vom Konsens in Paarbeziehungen
Der Konsens ist in Paaren gleichbedeutend mit dem Mehrheitsprinzip: Konsens ist Mehrheit, Mehrheit ist Konsens. An sich. In der Realität aber nicht immer. Es gibt Paare, da passiert immer das, was A will; mit oder ohne Konsens. A ist dann „dominant“. Ein normales Ehegelübde, eine normale Partnerschaft verpflichtet A und B zu einer Art Konsensprinzip, meine ich.
Aber was heißt schon „normal“? Vielleicht sind Dominanz und Submissivität für manche Leute normal. Dann ist allerdings Konsens im höheren Sinn möglich und auch nötig. Sonst wird das strafbare Freiheitsberaubung.
Ja, Paare brauchen Konsens. Ohne Konsens in wesentlichen Dingen werden Paarbeziehungen nicht lange halten. Aber auch bei Paaren ist Konsens keineswegs in allen Dingen sinnvoll und wichtig. Meine ich.
1.2. Vom Konsens in Kleingruppen (bis 5)
In Kleingruppen ist Konsens wichtig. Der Versuch, Konsens zu erzeugen, führt die Gruppenmitglieder einander näher, stärkt die Gruppe, definiert sie nach außen: „wir“ vs. „die“.
Wenn in einer Kleingruppe das Mehrheitsprinzip gilt, entwickelt sich oft entweder Unterdrückung oder eh eine Art Konsens. Wenn immer die gleichen 2 gegen dieselbe 1 abstimmen, ist das Unterdrückung und womöglich Freiheitsberaubung, die Gruppe ist langfristig nicht lebensfähig. Wenn in einer 5er-Gruppe sich 2 insgeheim auf einen Konsens verständigen und eine Koalition vereinbaren, werden sie schnell dominant. Verhalten sich die anderen 3 unkoordiniert, ohne Konsens, „zufällig“, gewinnen sie nur in einem von durchschnittlich 8 Fällen gegen die 2er-Koalition. Umgekehrt heißt das, dass die Verständigung auf Konsens innerhalb der kleinen Gruppe sehr stark macht.
Ja, Kleingruppen brauchen Konsens. Aber Konsens hat schon Gefahren.
1.3. Vom Konsens in mittleren und großen Gruppen (über 6)
Wenn mittlere und große Gruppen nach dem Konsensprinzip agieren, machen sie sich nicht stark, sondern schwerfällig. Entscheidungen sind sehr schwer zu treffen. Reformen gibt es kaum. Die Gruppe erstarrt und verkalkt; es bräuchte Mehrheitsentscheidungen. Der Konsens wird zur Schwächung.
Den Konsens könnte man in mittleren und großen Gruppen aber vom Gesetz (nur mehr) zur Regel abstufen. Man strebt ihn dann zwar an, führt ihn aber nicht zwanghaft durch. Das ist ein geeignetes Zwischenstadium. Das kann sich als Kollegialität äußern: „wir haben zwar keinen völligen Konsens, demonstrieren aber nach außen doch einen“.
Der Konsens als Regel kann da noch eine Zeit lang gut funktionieren, der Konsens als Gesetz ist extrem gefährlich.
1.4. Konsens in Massen
Konsens in Massen ist unmöglich, de facto. Praktisch ist Konsens in Massen meines Erachtens von Totalitarismus (Faschismus) nicht zu unterscheiden. Konsens in Massen ist lebensgefährlich. „Wollt ihr den totalen Krieg?!“ – „Ja!!!“ im Konsens (?).
Allerdings ist das dann meist auch gar kein Konsens mehr, sondern mehr oder weniger versteckte, konsensual übertünchte Diktatur.
2. Konsens im Anarchismus
In vielen anarchistischen Gruppen wurde das Konsensprinzip als Widerstand gegen Herrschaft versucht. Das kann gutgehen, solange die Gruppe klein ist. Man versteht in dieser anarchistischen Perspektive das Mehrheitsprinzip als Diktatur der Mehrheit gegen die Minderheit(en) und den Konsens als Stärkung der Kleinen, Schwachen.
Es gibt deshalb Organisationen, die sich im Widerstand gegen eine übergeordnete Organisation das Konsensprinzip verordnen – nein: ausmachen – z.B. Studentenorganisationen gegenüber einer „Mutterpartei“. Das macht die „Mutterpartei“ zunächst nicht glücklich, weil ihre Studierenden im Konsens widerständig und kaum zu bändigen sind. Die Mutterpartei selbst arbeitet ja schon lange nicht mehr nach dem Konsensprinzip; sie funktioniert selbstverständlich in Mehrheiten.
Doch das kann sich umdrehen. Die Unterorganisation, die im Konsens arbeitet, stabilisiert sich auf einem gewissen Niveau. Kaum jemand fällt weg, kaum jemand kommt dazu. Das ist auch für die übergeordnete Organisationsebene plötzlich praktisch. Die Untergruppe wird und ist kalkulierbar und bleibt es auch. Man kann sich arrangieren. Ein allfälliger Konflikt tarnt sich als Symbiose. Auch umgekehrt: Symbiose kann sich als Konflikt gerieren.
3. Die Wirkung von Konsens
Ich denke, die Wirkung von Konsens ist ganz wesentlich eine Funktion der Gruppengröße. Kleine Gruppen brauchen Konsens, speziell gegenüber herrschenden „Großen“. Auch Gruppen, die klein bleiben wollen, können das mit Konsens gut herstellen. Gruppen, die wachsen wollen, können nicht nur mit Konsens leben; ich meine sogar, dass sie Konflikt brauchen. Konflikt erzeugt Situationen, die Lösungen und damit Innovation benötigen. Konsens erzeugt nicht Innovation, jedenfalls nicht per se.
Konflikte lassen sich nicht mit der Forderung nach Konsens lösen.
Konsens kann anarchisch sein, Konsens kann faschistisch sein. Konsens ist nicht an sich gut oder schlecht.
Konflikt kann belastend sein, Konflikt kann Nerven kosten. Konflikt kann aber auch innovativ sein. Große Gruppen brauchen Konflikte, um sich entwickeln zu können; nicht alle Konflikte kann man im Konsens lösen.
4. Konsens in einer Schulverwaltung
Kann man in einer Schulverwaltung mit etwa 700 SchülerInnen und etwa 50 LehrerInnen nach dem Konsensprinzip arbeiten?
In der Gesamtgruppe sicher nicht.
Ich habe mir schon vor meiner Bewerbung als Direktor eine „Gruppe“ konstruiert, von der ich eine Art „Konsens“ über den Sinn einer Bewerbung erbat (und auch bekam; hätte ich ihn nicht bekommen, hätte ich nicht kandidiert). Das waren ca. 10 Personen, und zwar nicht unbedingt nur „Freunde“ oder „Freundinnen“. Im Moment der Konstruktion war mir selbst nicht völlig klar, was diese Gruppe ausmachte. Auch heute noch fällt es mir schwer, sie zu definieren. Es gibt sehr gute, hochgeschätzte FreundInnen, die nicht dabei waren.
Den Konsens dieser Gruppe suche ich auch heute noch. Mittlerweile hat sich eine kleinere Kerngruppe herausgeschält, in der ich regelmäßig nach Konsens frage. Wenn ich ihn dort nicht habe, ist das für mich ein Zeichen, dass eine Sache nicht völlig ausgegoren ist.
In der Gruppe des gesamten Lehrkörpers suche ich durchaus auch den Konsens, aber nicht als „Gesetz“, sondern nur als „Regel“. 50 Lehrpersonen sind für absoluten Konsens zu viel, aber Kollegialität ist durchaus erreichbar.
*
„Vom Konsens ists nicht weit zum Nonsens“. Das stand 1975 in unserer Maturazeitung. Besonders gescheit war das nicht; halt Maturazeitung.
Lit.:
de.wikipedia.org/wiki/Konsensprinzip
archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/17932/1/Weller_Das_Vertrags_und_Konsensprinzip.pdf
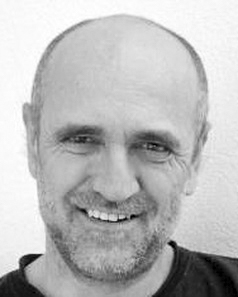
Schreibe einen Kommentar